
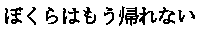
We Can‘t Go Home Again
-
ein Film von Fujiwara Toshi
[Inhalt]
[Bioraphie]
[Credits]
[Über den Film]
[Kritiken
&
Interview] [Pressematerial]
INHALT
Tokyo zu Beginn des
21. Jahrhunderts. In der extrem bevölkerungsreichen Metropole
kreuzen sich auf geheimnisvolle Weise die Wege von fünf jungen
Menschen, die alle auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind.
Mao
fühlt sich zur Zeit sehr unsicher. Sie arbeitet als
Redakteurin in einem Verlag für Filmbücher, aber
tagtäglich hat sie das Gefühl, zu wenig zu wissen und
zu unerfahren zu sein. Als wäre das nicht schon schlimm genug,
gibt es seit kurzem auch noch ein anderes Problem in ihrem Leben: Wohin
sie auch geht, fällt ihr ein junger Mann auf, der sie zu
verfolgen scheint.
Der Student Yushin arbeitet aushilfsweise
in dem Verlag. Er studiert Filmwissenschaft und ist glücklich
über diesen Job, durch den er sich der Welt des Films bzw. der
Erwachsenen zugehörig fühlt – auch wenn er
zur Zeit nur für das Lager zuständig ist. Privat ist
er frustriert, weil seine Freundin sich wie ein Kind benimmt und immer
zu spät zu den Verabredungen mit ihm erscheint.
Kurumi
arbeitet als ‘Queen‘ in einem Sado-Maso-Club, weil
sie früher einmal dachte, dass es ihr Vergnügen
machen würde,
Männer zu schlagen. Seit einiger Zeit
aber macht ihr die Arbeit nur noch wenig Spaß. Jedes
Wochenende trifft sie sich mit Masato, einem früheren
Schulfreund aus ihrer Heimatstadt, in einem Park. Mit ihm erlebt sie
keine erotischen Höhenflüge, aber dafür
entspannte Stunden. Masato studiert und steht kurz vor dem Examen,
weshalb Kurumi ihn für einen Intellektuellen und
künftigen Universitätsprofessor hält; doch
Masato hat offenbar ganz andere Pläne. Atsushi hat stets eine
Polaroidkamera bei sich und macht Fotos, wo er geht und steht
– allerdings nicht von den Orten, die er aufsucht, sondern
von seinem eigenen Gesicht ...



[zurück
nach
oben]
Credits
Originaltitel: Bokaru
wa mo kaerenai
Land: Japan 2006.
Produktion: Compass Films, Tokyo.
Regie,
Kamera, Schnitt: Fujiwara Toshi.
Improvisiert
nach Ideen von: Yamada Tetsuya, Torii Mao, Yamauchi Kazuhiro,
Shimoda Atsushi, Takasawa Kurumi, Kato Aya, Kuroda Yufuko.
Originalmusik,
Klangkomposition: Simon Stockhausen.
Songs:
Craft.
Ton: Kubota Yukio.
Ausstattung:
Ito Katsunori, Oshima Kanji.
Zusätzliche
Kamera: Yamada Tetsuya, Katori Yushin, Oshima Kanji.
Postproduktion:
Alex Wadouh.
Produzenten: Fujiwara Toshi,
Kan Hirofumi, Hirato Jun-ya, Alexander Wadouh.
Darsteller:
- Torii Mao (Mao),
- Shimoda
Atsushi (Atsushi, der Mann mit der Polaroid-Kamera),
- Takasawa
Kurumi (Kurumi, alias Satsuki),
- Katori Yushin
(Yushin),
- Yamada Tetsuya (der Stalker),
- Ito
Katsunori (Kawada),
- Fujiwara Tamaki (Yushins
Freundin),
- Yamauchi Kazuhiro (Kazuhiro),
- Dougase
Masato (Masato),
- Komuro Kayo (Saeko),
- Anna
(Madame Anna),
- Nakamura Akemi (Madame Nakamura),
- Fujiwara
Toshi (Filmkritiker).
Format:
35mm (gedreht auf DV-PAL), 16:9, Farbe. Länge: 111
Minuten, 25 Bilder/Sekunde. Originalsprache:
Japanisch. OmU Uraufführung: 14. Februar
2006, Internationales Forum des Jungen Films, Berlin.
Pressematerial
-
www.kinopresseservice.de


[zurück
nach oben]
Biografie
Fujiwara Toshi, geboren am 23. Juli 1970 in Yokohama, wuchs in
Tokyo
und in Paris auf. Er studierte Filmwissenschaft an der Waseda
University,
Tokyo, und am Fachbereich Film und Fernsehen der Uni-
versity
of Southern California. Bevor er selbst Filme drehte, arbeitete
er
als Filmkritiker. WE CAN’T GO HOME AGAIN ist sein erster
abend-
füllender Spielfilm.
Filme:
2002:
Independence: Around the film Kedma, a film by Amos Gitai
(Dokumentarfilm,
90 Min.).
Shalom – A Weekend in Tel Aviv (Video,
26 Min.).
Lights of Sainte Philomène (Video, 7
Min.).
2003:
Tsuchimoto Noriaki: A Voyage to New
York (Dokumentarfilm, 60 Min.).
Walk (Video, 9 Min.).
da
Speech or how 9/11 changed my nation and helped me to turn US against
the
world (Video, 7 Min.).
2004:
Fragments: On Amos
Gitai & Alila (Dokumentarfilm, 55 Min.).
Hara Kazuo:
A Life Marching On (Dokumentarfilm, 60 Min.).
2006:
WE
CAN’T GO HOME AGAIN.
[zurück
nach oben]
Über den Film:
Der
Regisseur über den Film:
Dieser Film entstand als
‘kollektive Improvisation‘ von Laiendarstel-
lern.
Jede/r von ihnen spielt eine Figur, die lose auf ihrer/seiner
eigenen
Persönlichkeit basiert. Die Handlung entwickelte sich aus Im-
provisationen
während der Dreharbeiten, aus dem Reagieren auf die
anderen
und auf die Umgebung, auf die Realität Tokyos, in der selbst
in
private Räume wie zum Beispiel Wohnungen permanent
Geräusche
und Lärm aus dem
öffentlichen Raum draußen eindringen. Die meisten
Szenen
wurden sorgfältig als ungeschnittene Sequenzen komponiert.
Mein
Wunsch war es, die Atmosphäre im Ganzen einzufangen, als
Bruchstück
oder Fragment unserer heutigen urbanen Realität, und zu
beobachten,
wie wir mit ihr zurechtkommen – bzw. sehr oft auch nicht
zurechtkommen.
Fujiwara
Toshi, Tokyo, Dezember 2005
Interview
Frage: Sie bezeichnen Ihren Film als eine „kollektive Improvisation”.
Können Sie Ihr Vorgehen etwas genauer beschreiben?
Fujiwara Toshi: Ich bin kein besonders einfallsreicher Mensch, und ich
bin nicht gut im Erfinden von Geschichten. Deshalb habe ich die Men-
schen, die sich für mein Projekt interessierten, gebeten, ihre jeweils
eigene Geschichte mit einzubringen. Diese Geschichten waren die
Grundlage für den Film; anschließend vertauschten wir die jeweiligen
Protagonisten und beobachteten, was geschah. Allerdings wollten wir
nicht die Geschichten selbst verwenden. Was ich brauchte, war eine
Reihe von Figuren; diese sollten auf den Persönlichkeiten der Darstel-
ler basieren und so die Grundlage für den Prozess der Improvisation
liefern. Aber es fällt Menschen schwer, zu erzählen, wer sie wirklich
sind. Ich glaube, die beste Art, um jemanden zu verstehen, ist es,
ihm oder ihr beim Erzählen eigener Geschichten und Erfahrungen zu-
zuhören. An der Art des Erzählens kann man viel erkennen. Deshalb
diskutierten wir als erstes über die Figuren, stellten Fragen, machten
uns gegenseitig auf Widersprüchlichkeiten aufmerksam etc.
Die Idee der kollektiven Improvisation stammt aus der amerikanischen
Independent-Szene der sechziger und siebziger Jahre; genauer gesagt
hat mich besonders Robert Kramer und die ‘Newsreel-Group’ (eine in
den sechziger Jahren entstandene Gruppierung politisch links stehen-
der Filmemacher, die in engem Kontakt mit der Studentenorganisation
‘Students for a Democratic Society‘/SDS stand; A.d.R.) inspiriert; ich
liebe seine Filme Ice (1970) und Milestones (1975), weil sie tatsäch-
lich das spezifische Lebensgefühl einer Epoche einfangen und vermit-
teln, was es heißt, jung zu sein. Auch Paul Morrissey experimentierte
in seinen frühen Filmen, die in Andy Warhols Factory entstanden, mit
diesen Themen. Und Nicholas Ray arbeitete am Ende seines Lebens
mit seinen Studenten an einem kollektiven Improvisationsprojekt, das
den Titel trug We Can’t Go Home Again – daher haben wir den Titel
für unseren Film entliehen. Ray stellte jenen Film niemals fertig, und
ich habe ihn auch nie gesehen. Obwohl ich seine Arbeit sehr bewun-
dere, bin ich bei diesem Projekt vermutlich mehr von Robert Kramer
beeinflusst, den ich gut kannte. Ich war früher Kritiker, und er schlug
mir vor, mit ihm gemeinsam einen Film in Japan zu drehen – daraus
wurde aber nichts, weil er 1999 plötzlich starb. Er war einer jener
Menschen, die mich dazu ermutigten, selbst Filme zu drehen. (...)
Die Gespräche mit Robert spielten eine wichtige Rolle bei meinem
Entschluss, diesen Film zu realisieren; unter anderem handelt es sich
hier um das typische Ergebnis eines ‘Wochenend-Drehs‘ – was meiner
Ansicht nach eine sinnvolle Herangehensweise war, da niemand ein
Projekt finanzieren wollte, dessen Ergebnis keiner voraussehen konn-
te. Außerdem habe ich diesen Titel, obwohl er von Ray stammt, für
meinen Film gewählt, weil Robert und ich oft über das Thema Heimat
gesprochen haben.
Frage: Ist dieser Film ein Versuch, Fiktion und Dokumentarisches zu
vermischen? Haben die Improvisationen mit Ihrem Hintergrund als
Dokumentarfilmer zu tun?
F.T.: Nein. Es stimmt, dass ich bereits einige Dokumentarfilme gedreht
habe, und es stimmt auch, dass dieser Film versucht, so viele Details
der Wirklichkeit wie möglich – zum Beispiel der Straßen – aufzugrei-
fen, aber Improvisation an sich hat nichts mit dem Genre Dokumen-
tarfilm zu tun. Obwohl ich im Vorfeld der Dreharbeiten keine einzige
Szene schriftlich fixiert hatte, komponierten, ja, choreografierten wir
doch einige von ihnen sehr sorgfältig. Wir benutzten nur einfach
keine schriftlichen Vorgaben und wussten deshalb so lange nicht, wie
die Geschichten sich entwickeln würden, bis wir tatsächlich mit den
Darstellern und den Kameras arbeiteten. Alles wurde am Set entschie-
den – aber das waren immer bewusste Entscheidungen, die sich auf
sehr organische Weise ergaben.
Ich glaube, dass die meisten Menschen eine falsche Vorstellung von
Improvisation im Film haben. Improvisation heißt nicht, dass man
etwas, was sich zufällig vor der Kamera abspielt, einfach abfilmt. Man
entscheidet sich für eine bestimmte Situation, und man improvisiert,
was darin geschieht. Man probt viel, wiederholt oft, spielt verschiede-
ne Varianten durch, erfindet etwas – so lange, bis eine befriedigende
Lösung gefunden ist. Ich hatte keine wirkliche Kontrolle über das,
was die einzelnen Protagonisten sagten oder taten; das blieb ihnen
überlassen. Meine Hauptaufgabe als Regisseur und Kameramann ist
es, offen zu sein, genau zu beobachten, herauszufinden, was wirklich
interessant ist und wie ich das am besten als Bild festhalte. Nichts-
destotrotz kann ich vorschlagen, dass bestimmte Dinge nicht wieder-
holt werden sollen, wenn ich sie schlecht finde oder wenn die Szene
zu lang und zu langweilig wird. Außerdem ließ ich die Darsteller oft
schneller oder langsamer agieren und gab vor, wo sie stehen oder ob
sie nach rechts oder nach links gehen sollten – so bekam ich visuell
interessantere Bilder. Das war wichtig, denn ich hatte mich von An-
fang an für lange Einstellungen entschieden.
Frage: Weshalb die langen Einstellungen?
F.T.: Zum Teil hatte das rein technische Gründe. Natürlich wiederhol-
ten wir Szenen mehrmals; die meisten Szenen, die im fertigen Film
zu sehen sind, entstanden bei der fünften oder sechsten Aufnahme
– aber es wurde niemals ein und dieselbe Sache wiederholt. Mit jeder
Aufnahme entwickelt sich die Szene, denn die Darsteller verstehen
die Situation und ihren Rhythmus immer besser. Sie fangen an, wäh-
rend der Aufnahme zufällige kleine Geschehnisse aufzugreifen und
bereichern damit die Szene. Zwischenschnitte wären hier nicht ganz
einfach gewesen, und außerdem hätte ich dadurch viele subtile Nuan-
cen verloren. Hinzu kommt, dass die Darsteller sich bei einer langen,
kontinuierlichen Einstellung besser konzentrieren, weil sie diese nicht
mittendrin vermasseln können; sie werden sensibler.
Improvisation ist ein organischer Prozess, deshalb war es naheliegend,
sich für lange Einstellungen zu entscheiden, in denen Szenen jeweils
als Ganzes enthalten sind. Besonders an öffentlichen Orten wie Stra-
ßen, Parks etc. hatten wir keinerlei Kontrolle über das, was sich im
Hintergrund abspielte. Umgekehrt beeinflusste der Hintergrund, was
wir taten. Dadurch vermittelt sich meines Erachtens auch das urbane
Lebensgefühl: Die Umgebung ignoriert vollständig, was einem einzel-
nen Menschen gerade passiert. Die Menschen haben keine Zeit, sich
darum zu kümmern oder auch nur zu bemerken, dass ein Mädchen von
einem Stalker verfolgt wird.
Ich wollte, dass die Kamera sowohl die Figuren möglichst vollständig
erfasste wie auch die Umgebung, die viel mit deren Verhalten zu tun
hatte. Es ist ein wenig, als hätte meine Kamera eine Überwachungs-
kamera simuliert, von denen man an einem Ort wie Tokyo so viele
sieht. Ich glaube, Coppola experimentierte in ähnlicher Weise in The
Conversation (1973) und noch mehr in Der Pate, Teil II (1974); die
Kamera scheint dem Erzählverlauf nicht auf melodramatische Weise
zu dienen. Sie fotografiert in erster Linie die Situation als Ganzes.
Wir, das Publikum, sollten dazu gebracht werden, die Bilder des Films
genau zu betrachten und uns mit einer eigenen Interpretation zu-
rückhalten. Die Kamera zeigt alle Elemente, die nötig sind, um die
Figuren zu verstehen, aber sie grenzt sich gegen den (...) primitiven
melodramatischen Wunsch ab, sich mit einer Figur zu identifizieren.
Vielleicht erfordert das einige Geduld von den Zuschauern, aber letzt-
endlich ermöglicht diese Haltung ein tieferes Verständnis menschli-
cher Verhaltensweisen.
Obgleich das ursprünglich nicht meine Absicht war, haben die langen
Einstellungen, glaube ich, viel mit der Tatsache zu tun, dass der Film
sich nicht zuletzt auch mit dem Medium Film selbst beschäftigt: Was
ist Kino? Was ist filmisches Erzählen? Und was bedeutet es, in Filmen
‘realistisch‘ zu sein? Diese Fragen wurden für unseren Film zu einem
wichtigen Subtext. Als Bertrand Tavernier den Rohschnitt sah, be-
zeichnete er ihn als „eine Fabel über das Schöpferische”.
Frage: Das war nicht beabsichtigt?
F.T.: Zumindest nicht von mir! Die meisten meiner früheren Dokumen-
tarfilme handeln von Filmemachern und vom Filmemachen – das war
wohl das Naheliegendste für einen ehemaligen Filmkritiker –, und von
diesen Filmen über das Thema Film hatte ich irgendwie genug. (...)
Aber dann stellte sich heraus, dass viele der jungen Mitwirkenden sich
für Kino interessieren. Einige von ihnen studieren sogar Filmwissen-
schaft. Für den Verlag ‘Film Art Publishing’, der im Film vorkommt,
habe ich früher als Kritiker gearbeitet. Ito Katsunori, der den Chef
spielt, war mein Redakteur. Wir brauchten einen Ort, an dem das
Mädchen Mao und der Junge Yushin arbeiteten. Katsunori bot uns an,
das Büro an den Wochenenden zu nutzen. Das war eine gute Wahl, die
den Darstellern half, in ihre Rollen hineinzukommen.
Torii Mao, die die junge Redakteurin spielt, hatte eines Tages die
Idee, dass ihre Figur ein Buch über das Schauspielen machen wollte;
im Verlauf der Dreharbeiten interessierte sie sich immer mehr für die
Schauspielerei, also übertrug sie das einfach auf die Figur, die sie
spielte. Sie zwang mich, in diesem Film mitzuspielen! Ich muss zu-
geben, dass ich so nervös beim Spielen war, dass ich erst verstand,
was sie tat, als wir die wunderbare Telefonszene drehten, eine einzige
Einstellung von viereinhalb Minuten Länge. Ich liebe diese Szene, weil
sie so minimalistisch ist. Außerdem gelingt es Mao tatsächlich, mit
ihrem improvisierten Text das gesamte Spiel hinter diesem Improvisa-
tionsprozess zu erklären. Dank ihr wurde der Film eine Art Spiegelsaal
– er reflektiert den Prozess seines eigenen Entstehens.
Frage: Wie steht es mit den Verweisen auf andere Filme, mit denen
Sie so häufig arbeiten?
F.T.: Das ließ sich auch diesmal nicht verhindern, da es mehrere Fi-
guren in dem Film gibt, die in einem auf Filmbücher spezialisierten
Verlag arbeiten. Ich wollte keine ‘Hommage an die Nouvelle Vague’
drehen, aber Filme entwickelten sich im Verlauf der Dreharbeiten ein-
fach zum Hauptgesprächsthema. Die meisten werden mehr oder weni-
ger witzig behandelt. Ich glaube, ich sollte mich besonders bei den
Fans von Theo Angelopoulos entschuldigen. (...)
Frage: Sind die Schauspieler wirklich Laien?
F.T.: Bis auf zwei hat keiner von ihnen auch nur in einer Schulauf-
führung mitgewirkt! Deshalb brauchten wir alle viel Geduld – aber
nachdem die Dinge ins Rollen gekommen waren, lief alles prima. Wir
begannen mit den Dreharbeiten im April, aber das früheste Material,
das in der Endfassung enthalten ist, stammt vom Juni. Die meisten
Szenen entstanden nach dem August. Sämtliche Szenen im Verlag
wurden im Anschluss an jene Szene gedreht, in der Maos Figur sich
zur Rache an ihrem Stalker Yamada Tetsuya entschließt. Das war eine
schwierige Szene, und ich musste enormen Druck auf Mao ausüben,
um sie bis an diesen Punkt zu bekommen. Danach war sie völlig
verändert, und ich konnte nichts mehr von dem verwenden, was wir
vorher gedreht hatten. Aber das war wunderbar.
Frage: Sie haben also nicht chronologisch gedreht?
F.T.: Ich weiß, dass dies die wichtigste Regel beim Filmemachen ist:
Wenn man gute darstellerische Leistungen will, muss man so viel wie
möglich chronologisch drehen. Anfangs dachte ich, ich müsste dieser
Drehbuch-Regel folgen, aber dann ließ ich es irgendwann sein. Die erste
Szene des Films ist in Wirklichkeit die letzte, die wir drehten – und zwar
mehr als ein Jahr nach Drehbeginn.
Frage: Sie sprachen eben von dem Druck, den Sie auf Ihre Darstellerin
ausgeübt haben. Waren Sie als Regisseur freundlich zu Ihren jungen
Laiendarstellern?
F.T.: Das müssen Sie sie selbst fragen! Vielleicht war ich hin und
wieder sehr grob ... Meistens habe ich sie aber in der Freiheit, die
sie hatten, bestärkt und keinerlei psychologische Vorgaben für die
Umsetzung einer Szene gemacht. Das hätte auch gegen die Regeln
dieses besonderen Spiels verstoßen. (...) Ich denke, wenn ein Schau-
spieler seine Motivation nicht selbst findet, liefert er auch keine gute
Leistung ab. Andererseits hat Kino auch damit zu tun, dass Gefühle
künstlich erzeugt werden. Man bringt jemanden zum Weinen und stellt
ihn anschließend in einen bestimmten Zusammenhang – schon liegt
der Grund, weshalb er weint, im Kontext der Handlung. Das Publikum
wird nie erfahren, dass der Schauspieler weint, weil der Regisseur ihn
schikaniert hat!
Frage: Tokyo spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Film …
F.T.: Das stimmt. Die einzige Bedingung, die ich den Mitwirkenden
stellte, war, dass die Geschichten, die sie in den Film mit einbringen
würden, in dieser riesigen Stadt spielen mussten. Da die Dreharbei-
ten an Wochenenden stattfinden sollten, hätten wir nicht genug Zeit
gehabt wegzufahren. Außerdem ist diese Stadt mit dreizehn Millio-
nen Einwohnern ein idealer Ort, um mehrere Menschen, die scheinbar
nichts miteinander zu tun haben, einander zufällig oder auch absicht-
lich begegnen und Beziehungen zueinander entwickeln zu lassen.
Ich glaube nicht, dass das japanische Kino sich bisher wirklich mit
dieser Stadt befasst hat – abgesehen von einigen Stummfilmen aus
der Zeit vor dem Krieg und von Tokyo monogatari (1953), in dem es
Ozu gelang, die Schönheit dieser Stadt zu zeigen, ohne sie selbst zu
zeigen! Ich wollte immer einen Film über Tokyo machen und darüber,
was es heißt, in dieser Metropole zu leben; ich wollte die Vitalität, die
Energie der ungeheuren Zahl von Menschen, die hier leben, einfangen
– trotz der Einsamkeit, der Entfremdung, der man nicht entkommt,
denn im Grunde sind wir von Fremden umgeben. Siebzig Prozent der
Menschen hier kommen von woanders her – aus ganz Japan, und in-
zwischen auch aus ganz Asien. Mit Ausnahme einiger Jahre, die ich im
Ausland lebte, bin ich in Tokyo aufgewachsen. Meine Eltern stammen
jedoch aus Kobe und Hiroshima. Im Rahmen der nostalgischen Verklä-
rung, die die Medien heutzutage stark betreiben, wird Tokyo meistens
entweder als glamouröser (aber letztendlich künstlicher) Ort oder als
Ort der Entfremdung betrachtet, an dem man sich nicht heimisch fühlen
kann, weil die Heimat woanders ist. Die Japaner hängen im allgemeinen
sehr an solchen nostalgischen Betrachtungsweisen; mein Vater bei-
spielsweise, der seit über vierzig Jahren hier lebt, spricht innerhalb der
Familie und unter Freunden noch immer seinen Kobe-Dialekt.
Frage: Daher also auch der Titel ‘We can’t go home‘?
F.T.: Ja. Wie schon erwähnt, habe ich mich über den Begriff Heimat
früher oft mit Robert Kramer unterhalten, der in New York geboren
wurde, aber während der letzten zwanzig bis dreißig Jahre seines Le-
bens in Europa lebte und sich mit Vietnam stärker verbunden fühlte
als mit Europa oder den USA. In seinem Film Doc’s Kingdom (1987)
zum Beipiel wird der amerikanische Arzt, der in Portugal lebt, von
seinem Sohn gefragt: „Möchtest du nicht nach Hause zurück?”, und
er antwortet: „Nach Hause? Hier bin ich zu Hause!” Daher stammt der
Titel des Films. Ich selbst bin teilweise in Paris aufgewachsen und
habe ebenfalls keine Bindung an eine ganz bestimmte Heimat. In
der heutigen Welt sind viele Menschen vertrieben und abgeschnitten
von ihren ethnischen, kulturellen, religiösen oder nationalen Wur-
zeln. Besonders in großen Städten wie Tokyo, Berlin, New York, Paris,
Taipeh oder Tel Aviv. In Tokyo und Berlin finden sich eher wenige
offensichtliche historische Spuren, da beide relativ neue Städte sind,
die im Krieg zerstört wurden. Tokyo wurde zweimal zerstört: vom gro-
ßen Erdbeben 1923 und 1945 durch die Bombenangriffe. Natürlich
gibt es Spuren der Vergangenheit, historische Bauten – aber nicht
wie in Paris, das insgesamt noch immer sehr vom achtzehnten und
neunzehnten Jahrhundert geprägt ist. Städte wie Berlin und Tokyo
sind Orte für vertriebene, entwurzelte Menschen – was oft als etwas
Negatives aufgefasst wird; ich sehe das aber nicht so.
Frage: Sie meinen, das sind Orte, an denen man frei ist, an denen man
seinen Lebenstraum realisieren kann?
F.T.: Nein, nicht zwangsläufig, denn sicherlich bringen Großstädte
zahlreiche Probleme mit sich, und das Leben in ihnen ist nicht leicht.
Tokyo ist verglichen mit anderen Städten sicher, aber es ist dennoch
ein Dschungel. Ich möchte große Städte ganz bestimmt nicht ideali-
sieren, wie das in dem Song New York, New York geschieht. Ich würde
sagen, es gibt dort mehr Möglichkeiten als in kleinen Gemeinden,
aber, erfolgreich sind am Ende nur wenige. Das ist übrigens auch eines
der Themen unseres Films (...). Nichtsdestotrotz ist das Thema ‘seinen
Lebenstraum realisieren‘ wichtig – eine der bekanntesten japanischen
Popbands heute heißt Dreams Come True. Wir haben uns mit dieser
Frage aus einem neuen Blickwinkel zu beschäftigen versucht, und das
war wirklich ein Ergebnis von kollektiver Improvisation: „Warum jagen
wir einem Traum nach?” (...) Auch dies hat mit der Idee von Hei-
mat zu tun, von dem Ort, wo man hingehört, und mit der Frage der
Identität. (...) Selbstverständlich braucht man als Filmemacher eine
gewisse Lust und Leidenschaft, sogar Ehrgeiz; aber man muss extrem
besonnen sein, wenn man Klarheit darüber gewinnen will, wofür man
sich wirklich interessiert und was man wirklich fähig ist zu tun. Und
das kann man nicht allein erreichen.
Frage: Genau das finden die Protagonisten dieses Films am Ende heraus.
F.T.: Ja. Aber noch einmal: Ich habe diese Entwicklung im Film nicht
forciert; das waren die Darsteller. Ich habe nur die Möglichkeiten in
dem gesehen, was sie taten, und das Ende gefunden. Vielleicht ist die
letzte Szene die einzige, die von mir stammt. (...)
Interview: Katori Yushin, Tokyo, Dezember 2005
[zurück
nach
oben]

