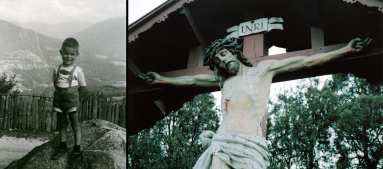Der
Pfad des Kriegers
[Inhalt]
[Biographie]
[Credits]
[Über den Film] [Pressematerial]
INHALT
Kurzinhalt
Erste Welt, Du bist die Letzte
Die Geschichte von Michael, dem Ministranten aus Südtirol, der in
Bolivien zu Comandante Miguel wird.
Als angehender Priester will Michael noch friedlich gegen Armut
kämpfen, für die Verzweifelten, für mehr soziale Gerechtigkeit. Doch
mit 29 Jahren geht er in den Untergrund und entführt einen
Industriellen. Bei der Befreiungsaktion erschiesst ihn die Polizei.
1990, im Deutschland der Wendezeit, geht die Todesnachricht unter.
Nach den Ereignissen des 11. September 2001 begibt sich
Grimme-Preisträger Andreas Pichler auf die Spuren
seines Jugendfreundes. Auf die Spur einer Radikalität, die ihm im Laufe
seiner
Recherche immer weniger abwegig erscheint.
War Miguel verblendet oder beseelt? War er ein Überspannter oder ein
Märtyrer?
Der Film zeigt, wie ein Junge aus gutem Hause das „Gottesreich auf
Erden“ sucht
und darüber zum Terroristen wird. Ein Lebenslauf, der uns heute nur
allzu bekannt
vorkommt.
Inhalt
La Paz, 1990. Nachrichtenbilder, hektische Reporter, grobkörnige Fotos.
Seit
Monaten hat das Kommando Nestor Paz Zamora den Coca-Cola-Repräsentanten
von
Bolivien in seiner Gewalt. Der Innenminister fordert die Geiselnehmer
auf, sich zu
ergeben. Doch es kommt zu keinem friedlichen Ende. Bewaffnete Soldaten
stürmen
das Haus, in dem sich die Gruppe verschanzt hat. Comandante Miguel, 29
Jahre alt
und als Missionar aus Deutschland gekommen, springt aus dem Fenster und
wird
wie die Geisel und zwei seiner Gefährten erschossen.
Südtirol, ein Winter in den siebziger Jahren. Michael rast auf seinem
Schlitten den
steilen Abhang hinunter, aber er hat keine Angst. Er dreht sich sogar
lachend zur
Kamera um, die die Schussfahrt in wackligen Bildern verfolgt. Winter in
Tirol hieß
Tiefschnee. Jugend im provinziellen Bozen, das hieß Jungschar - „und
danach
Ministrant. So war das eben“, sagt der Dokumentarfilmer Andreas
Pichler, der sich
auf die Spur seines Kindheitsfreundes begibt. Michael war sein Vorbild,
als sie in
einem Milieu aufwuchsen, in dem sich alles um die Pfarrkirche drehte.
Schon als Jugendlicher ein Idealist und Romantiker, beschließt Michael
mit 18 Jahren,
Missionar zu werden. Er studiert in London und geht 1982 als
Jesuiten-Novize nach
Lateinamerika.
Es ist die Zeit der Nicaragua-Poster und Sandinista-Platten. Auch der
junge Mann
aus Tirol will die Welt verändern. Er lässt sich mitten unter den Armen
Boliviens
nieder, er lernt das soziale Elend kennen, die grauenhaften Slums von
El Alto, die
Minen in Potosi. Er arbeitet Tag und Nacht, beginnt, sich mit den
Unterdrückten zu
identifizieren und nennt sich jetzt Miguel. Sein Unmut gilt besonders
der
Ausbeutung der Entwicklungsländer durch die sogenannte Erste Welt. Nach
Hause
zur Mutter und zum Bruder schickt er Cassetten, auf denen er
bolivianische
Volkslieder singt. Und irgendwann steht in seinen Briefen, die Lehre
Jesu könne nur
mit Waffengewalt durchgesetzt werden.
Michaels Freunde betrachten seinen Tod als das traurige Ende einer
modernen
revolutionären Bewegung, deren Stadtguerilla in Europa längst
gescheitert war.
Pichler muss wieder an ihn denken, als 2005 ein paar junge Männer eine
Londoner
U-Bahn in die Luft jagen. Die Radikalen, denen der Glaube aus dem Ruder
lief - sie
sind gebildete junge Männer aus dem Mittelstand, liebenswerte Nachbarn,
sozial
engagiert. Wollte Michael, dessen Kampf den Machtlosen und Gedemütigten
galt,
der sich für ein „Gottesreich auf Erden“ einsetzte, wollte auch er ein
Märtyrer sein?
Der Film beginnt seine Suche beim Kruzifix in der Tiroler Dorfkirche.
In der Brust
Jesu, da, wo das Herz ist, klafft eine tiefe, blutende Wunde. Michaels
Bruder meint,
der Jesus ihrer Kindheit sei „eher ein Softie“ gewesen. Der Mutter
fällt es noch
heute schwer, über das verlorene Kind zu sprechen.
Pichler reist nach Bolivien, um die Orte und Menschen aufzusuchen, die
in Miguels
Leben eine Rolle spielten. Und findet alles vor, wovon in Miguels
Briefen und
Tagebüchern die Rede war. Verwahrlosung, Verzweiflung, die Niederlage
jeder
Vernunft. Der Gedanke, dass mit herkömmlichen Mitteln auf dieser Welt
nichts
mehr auszurichten sei, scheint hier gar nicht so abwegig. Die
detektivische
Spurensuche wirft Fragen auf, Fragen nach verlorenen Idealen und den
Werten
einer ganzen Generation.
Michaels Briefe und sein Tagebuch der Geiselnahme lassen ihn im Film
lebendig
werden. Ehemalige Mitglieder des Kommandos erzählen - noch immer
bewundern
sie seinen Ernst, seine Disziplin, und belächeln sein Ungeschick im
Handwerk des
Guerilleros. Doch er selbst beschreibt die Zerrissenheit, die aus der
Ungeduld
entsteht, er selbst erkennt den „Scheideweg“, als er vor ihm steht. Der
Film kann
deshalb tief in Miguels Herz und Kopf sehen. In die Psyche eines
unerfahrenen
Kämpfers und erprobten Gläubigen, der diesen Widerspruch nicht
überlebte.
[zurück
nach
oben]
Credits
Deutschland
/ Schweiz / Italien 2008, 91 Minuten
Mit:
Flora
Nothdurfter, Otwin Nothdurfter, Ludwig Thalheimer, Dante
Limaya, Paola
Acasigue,
Gonzalo Muñoz, Roberto Ibarguen, Sonia Brito,
Rafael Puente
Buch und Regie:
Andreas Pichler
Kamera:
Susanne Schüle
Ton und Sound Design:
Stefano Bernardi
Montage:
Marzia Mete, Andreas Zitzmann
Musik Paul
Lemp
Mischung
Hartmut Teschemacher, Konken Studios
Produzent
Thomas Tielsch
Koproduzenten
Samir, Valerio Moser
Redaktion ZDF
Burkhard Althoff
Redaktion ARTE Kathrin
Brinkmann
Line Producer
Britta Erich
Aufnahmeleitung
Tobias Steinhauser, Paola Gosalvez
Produktionsassistenz
Nora Ambun-Suri, Jan-Peter Heusermann,
Anna Thayenthal, Regina Calvo (La Paz)
Recherche und Exposé Martin
Kucera
Produktionsleitung (CH)
Tunje Berns
Zweite Kamera
Osmund Zöschg, Martin Prast
Farbkorrektur Robin
Schmude, Chroma
Grafik Fabian
Reber
FAZ
Schwarzfilm
Sprecher Felix
Kramer, Andreas Pichler
Filmtank in Koproduktion
mit Dschoint Ventschr Filmproduktion, Miramonte Film,
ZDF – Das Kleine Fernsehspiel
In Zusammenarbeit mit ARTE, Schweizer Fernsehen, RAI - Sender Bozen
Gefördert von FilmFörderung Hamburg, BKM, Züricher
Filmstiftung,
Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Entwickelt mit Unterstützung des MEDIA-Programms der EU
Pressematerial
-
www.kinopresseservice.de
[zurück
nach
oben]
Biografie 
Biografie
Andreas Pichler wird 1967 in Bozen/Italien
geboren. Er besucht dort die Schule für
Fernsehen und Film Zelig, studiert danach Film- und
Kulturwissenschaften an der
Universitá degli Studi di Bologna und Philosophie an der Freien
Universität Berlin,
wo er mit dem Magister abschliesst . Während des Studiums realisiert er
mehrere
Kurz- und Tanzfilme sowie Videoinstallationen, die auf zahlreichen
Festivals
Anerkennung finden und Preise gewinnen. Seit Ende der 90er Jahre
arbeitet er
hauptberuflich im Bereich Dokumentarfilm. Viele seiner Filme sind mit
Europäischen
Förder- und Fernsehanstalten koproduziert ( z.B. ZDF, ARTE, ORF, RAI,
YLE,
IKON, 3sat) und waren auf zahlreichen internationalen Festivals zu
sehen.
Für seinen Film „Call me Babylon" (Produktion: filmtank) wurde er 2004
in
Deutschland mit dem Adolf Grimme Preis als Autor und Regisseur
ausgezeichnet.
Heute arbeitet Andreas Pichler in Deutschland, Italien, Österreich
und der Schweiz.
Filme
Franco D’Andrea
– Jazz Pianist, Dokumentarfilm, 55 min, I 2006
August auf der Flucht,
Dokumentarfilm, 48 min, I / 2006
Meine 3 Zinnen,
Dokumentarfilm, 41 min, I/A/F/SF 2005
Yin und Yang im Allgäu,
Doku-Serie, 5 x 26 min, D 2005, ZDF/arte, filmtank
Antonio Negri – eine
Revolte, die nie endet, TV-Dok., 52 min, D/S/SF 2004
Call me Babylon,
Dokumentarfilm, 75/52 min, D/NL/B 2003 (filmtank)
Alles, was ich brauch –
Leben zwischen 15 und 18, TV-Dok, 43 min, 2003,
Musik als Dauerzustand –
Der Komponist Max Reger, TV-Dok., 43 min, I 2002,
Mirabella-Sindelfingen,
Dok., 54 min, D / I / DK 2001 (filmtank)
[zurück
nach oben]
Über
den Film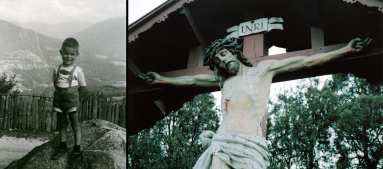
Zwischen
dem Deutschland der Bleiernen Zeit und dem Aufmarsch der
Globalisierungsgegner in den Abendnachrichten liegen gut 20 Jahre, in
denen die
Geschichte von Michael alias Miguel Zeit zum Reifen hatte. Der
preisgekrönte Dokumentarfilmer Andreas Pichler portraitiert in PFAD DES
KRIEGERS nicht nur einen Freund aus seiner Kindheit, der mit 29 Jahren
sterben musste. Er gräbt auch verschüttete Erinnerungen an einen
Idealismus aus, mit dem sich junge Post-68er
voller Wucht und Sehnsucht auf Lateinamerika warfen. Über dem enormen
medialen Aufwand zum Thema RAF sind die Venceremos-Romantik, die
Ponchos und Dritte-Welt-Läden ein wenig in Vergessenheit geraten.
Ebenso, dass es in der seinerzeit so geschmähten Null-Bock-Generation nicht wenige gab, die
vorhatten, die Welt zu verändern. Und zwar am anderen, unteren Ende der
Welt.
Doch es ist schließlich der 11. September 2001, an dem Pichler sich die
Fragen stellt, die seinen Film bestimmen, und die sich aus dem
ungewöhnlichen, manchmal wie gelenkt wirkenden Leben Michaels ergeben -
aus der „Chronik eines angekündigten Todes“, wie ein überlebender
Kampfgenosse wehmütig lächelnd sagen wird. Denn die
Selbstmordattentäter von Manhattan wollten sterben, sie taten es
ausdrücklich in Erfüllung ihres Glaubens, der den „Märtyrern“ das Paradies versprach.
Und Michael? Der im beschaulichen
Tirol der Siebziger als
Christ erzogen worden war, der in einer Franziskanerschule eine
„gediegene
moralische Erziehung“ genossen hatte und nach Lateinamerika ging, um
Gottes Wort zu verbreiten? Auch ihm, der später Sprengstoffattentate
verübte und einen
Manager als Geisel nahm, war der Zusammenhang zwischen Glaube und Tod
früh
bewusst. In seinem Tagebuch fragt er sich, „wie lange ich es wohl am
Kreuz
aushalten werde“.
Er schreibt in einem Brief an die Mutter über Christen, die bereit
waren, für ihre Religion Folter und Tod auf sich zu nehmen. Als sich schließlich seine
große Liebe von ihm trennt, kündigt er an, den „Krieg der Liebe bald ganz zugunsten
des Krieges der Politik aufzugeben, denn dieser erscheint mir viel einfacher.“ Und
das Wort
„Krieg“ scheint ihm da keineswegs zu radikal.
Bewusst verzichtet Pichler darauf,
aus dem gottesfürchtigen Michael
oder dem späteren Terroristen Miguel eine Filmfigur zu machen. Bewusst
führt er
selbst als Ich-Erzähler durch den Film, der eine Reise von der Tiroler
Pfarrkirche
ins heutige Bolivien unternimmt. Denn die ausführlichen, in Briefen und
Tagebüchern überlieferten Gedanken - manchmal Grübeleien - von Michael
sind alles
andere als tot. Sie führen Pichler an Orte, an denen von dem Freund wie
von einem
Helden gesprochen wird, an dem heute noch Menschen Tränen über sein
Schicksal
vergie‡en. Ein Genosse hat seinen Sohn nach ihm benannt, eine Mutter in
einer ländlichen „Comunidad de Trabajo“ erinnert sich bewegt, wie Miguel mit
ihnen lebte und frühmorgens mit zur Feldarbeit ging, „als gehöre er zu
unserer Familie.“
Und die Mitglieder seiner Guerilla-Gruppe, die zum Teil lange
Haftstrafen hinter sich haben, sprechen ehrfürchtig von Michaels Intelligenz, von seiner
Disziplin und Beharrlichkeit. Einer von ihnen weist darauf hin, welch „grosses
Potential“ die Kämpfer hatten, dass sie in einem anderen Leben vielleicht Ärzte,
Anwälte, Priester geworden wären - eine weitere Parallele zu den Attentätern von London,
Madrid oder New York.
Der Film zeigt auch den abenteuerlustigen jungen Mann, der auf der
Gitarre Beatles-Lieder spielt und den Applaus seiner neuen bolivianischen Freunde
genießt: „Vielleicht werde ich ein Pop-Star“. Und den etwas linkischen
Intellektuellen, der sich so garnicht für die Pirsch durch den Dschungel und ähnliche
Anforderungen des
Guerrillero-Lebens eignete.
DER PFAD DES KRIEGERS kommt den Motiven des jungen Gläubigen so nahe,
weil er das schreckliche Ende nicht als Ergebnis eines Bruchs beschreibt.
Vielmehr stösst Pichler bei seiner Bildersuche auf die gleichen Szenen, denen Michael
vor 25 Jahren entsetzt beigewohnt hat. Er sieht die gleichen Minenarbeiter in der
Misere, er sieht
das gleiche soziale Elend, er sieht das, was Miguel nach dem Kontakt
mit den Marxisten der Universität die „Ausbeutung der Dritten durch die erste
Welt“ nannte. Und er kann den Heiligen Zorn, wenn nicht billigen, so doch
nachvollziehen, der den angehenden Missionar bewegte.
Zumindest wird ihm bewusst, wie sehr sein damaliger Freundeskreis,
vielleicht auch seine Generation, noch von der Idee beseelt war, eine andere Welt sei
möglich. Wie aber viele von ihnen „für diesen Kampf zu spät kamen“, oder sich
garnicht erst hineinbegeben wollten.
Dass sein Freund tatsächlich und
in verhängnisvoller Weise zum Krieger
geworden war, erkannte Pichler, wie auch Michaels Familie, erst nach
seinem Tod.
Nur der Bruder spricht von einem Indiz der radikalen Wandlung, das noch
in ihren Jugendtagen liegt. Als sie nämlich entdeckten, dass der
„Softie“-Jesus
ihrer Kindheit in Wirklichkeit ein sozialer Rebell und Revolutionär
war. „Das machte
ihn plötzlich greifbar und nachvollziehbar“.
Pichlers Kommentar besteht darin,
Michaels Weg in den Kontext der Befreiungstheologie zu stellen, die
damals den Alltag der unterdrückten
und bettelarmen Bevölkerung in Lateinamerika prägte. In Archivaufnahmen
zeigt er die Priester der „Armenkirchen“, wie sie im Kampfanzug in
Dschungelcamps
sitzen. Sie predigen die dem Vatikan - und den Regimes - so verhassten
sozialistischen Ideen, weil „in einer extremen Notsituation die
lebensnotwendigen Dinge allen
gehören.“
Mit den Bildern der verarmten
Mineros, die sich selbst öffentlich
„kreuzigten“, um gegen ihre ausweglose Lage zu demonstrieren, scheinen
Christentum und Widerstand eine unwiderlegbare Verbindung einzugehen.
In PFAD DES KRIEGERS ist die Mär vom Märtyrer nicht als „eine
erbauliche, eine abschreckende Erzählung“ gedacht, sondern als Ausflug in die Psyche
eines Menschen, der die Pflicht zur Auflehnung spürt. Der Kreis zwischen den Lateinamerika-Romantikern der Achtziger Jahre, den
heutigen Globalisierungsgegnern
und den islamischen Gotteskriegern kann sich niemals schließen. Aber
was in seiner Mitte liegt, so erinnert uns Pichler, geht nicht nur die Radikalen
etwas an. Wenn es stimmt, dass erst das Ende einem Leben seine Logik verleiht,
dann muss uns Michael als Terrorist in Erinnerung bleiben. Wenn nicht, dann war
er einfach ein
menschlicher Christ, dem zum Verhängnis wurde, was eine typische Sünde
der Jugend ist: Die Ungeduld.
Der Regisseur Andreas
Pichler über seinen Film:
Der Tod von Michael hat mich damals, 1990, sehr getroffen. Als der
islamistische Terror in Europa in die Schlagzeilen rückte, musste ich
wieder
an ihn denken, und daran, dass es auch bei uns im Westen und damals vor
allem in den linken Bewegungen immer wieder junge Menschen gab, die
bereit waren, für den politischen Kampf sogar ihr Leben zu opfern.
Diese Geschichte heute zu erzählen, ist für mich der Versuch
herauszufinden, was
damals in Michaels Kopf ablief und was in seinem Umfeld wirklich Thema
war.
Und es ist der Versuch zu verstehen, was junge Leute dazu bewegt, den
Märtyrertod zu
suchen.
[zurück
nach oben]