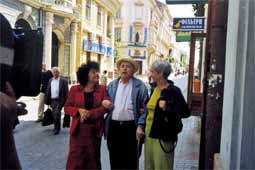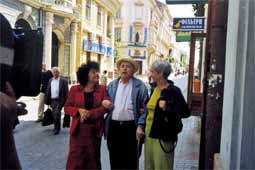|
[Inhalt] [Biofilmographie] [Credits]
[Interview]
Inhalt Czernowitz, eine entlegene Stadt in der Mitte Europas. Als Hauptstadt
des Kronlandes Bukowina war sie einst Teil der österreichisch-ungarischen
Monarchie. Hier lebten Menschen verschiedener Nationalitäten,
Sprachen und Kulturen miteinander: Ukrainer, Rumänen, Deutsche,
Polen, Huzulen. Beinahe die Hälfte der einst einhundertfünfzigtausend
Einwohner von Czernowitz waren Juden. Der Süden der Bukowina gehört
heute zu Rumänien, der Norden mit Czernowitz (heute: Tscherniwzi)
zur Ukraine. Dort drehte Volker Koepp vor sechs Jahren den Film Herr
Zwilling und Frau Zuckermann. Rosa Roth-Zuckermann und Mathias Zwilling
waren zwei der letzten noch im alten Czernowitz geborenen Juden,
die den Krieg und die Lager Transnistriens überlebt hatten und in
ihrer Stadt geblieben waren.
Die im vergangenen Jahrhundert aus der Bukowina geflüchteten Juden
haben Exil in vielen Teilen der Welt gefunden. In ihren Familien
wirken die Erinnerungen an Menschen, Lebenswelten und Landschaften
nach. Mit Emigranten und deren Nachkommen kehrt der Film DIESES
JAHR IN CZERNOWITZ dorthin zurück. Der Cellist Eduard Weissmann
macht sich von Berlin aus auf den Weg, aus Wien kommen die Schwestern
Evelyne Mayer und Katja Rainer, aus New York der Schauspieler
Harvey Keitel und der Schriftsteller Norman Manea. Die Fahrt zu den
mythischen Orten ihrer Herkunft führt sie nicht nur in die Vergangenheit,
sondern auch in die Gegenwart, zu Menschen, die heute in Czernowitz
leben, zur ukrainischen Studentin Tanja und dem beinahe neunzigjährigen
Deutschen Johann Schlamp.
zurück nach oben
Biofilmographie Volker Koepp wurde 1944 in Stettin geboren. Nach dem Abitur 1962
machte er eine Ausbildung als Maschinenschlosser und arbeitete als
Facharbeiter. Von 1963 bis 1965 studierte er an der Technischen Universität
in Dresden, dann an der Hochschule für Filmkunst in Babelsberg.
Von 1970 bis 1990 war Volker Koepp Regisseur am DEFA Studio
für Dokumentarfilm.
Filme:
1971: Schuldner. 1972: Grüße aus Sarmatien. 1973: Gustav J. 1974:
Slatan Dudow. 1975: Mädchen in Wittstock (Forum 1977). 1976: Das
weite Feld. Wieder in Wittstock (Forum 1977). 1977: Hütes-Film. 1978:
Am Fluß. Wittstock III. 1979: Tag für Tag. 1980: Haus und Hof. 1981:
Leben und Weben. 1982: In Rheinsberg. 1983: Alle Tiere sind schon da.
1983-85: Afghanistan 1362 – Erinnerung an eine Reise. 1984: Leben in
Wittstock (Forum 1985). 1985: An der Unstrut. 1986: Die F96. 1987:
Feuerland. 1988/89: Märkische Ziegel. 1989/90: Arkona-Rethra-Vineta.
1990: Märkische Heide, Märkischer Sand. 1991: Märkische Gesellschaft.
In Karlshorst, In Grüneberg. 1992: Neues in Wittstock. Sammelsurium –
Ein Ostelbischer Kulturfilm (Forum 1993). 1993: Die Wismut. 1995: Kalte
Heimat (Forum 1995). 1996: Fremde Ufer. 1997: Wittstock, Wittstock
(Forum 1997). 1999: Herr Zwilling und Frau Zuckermann (Forum 1999).
2001: Kurische Nehrung/Curonian Spit (Forum 2001). 2002: Uckermark
(Forum 2002). 2004: DIESES JAHR IN CZERNOWITZ.zurück nach oben
Credits Regie: Volker Koepp
Land: Deutschland 2004. Produktion: Vineta Film, Berlin.
Kamera: Thomas Plenert. Schnitt: Angelika Arnold.
Ton: Uve Haußig. Produktionsleitung: Fritz Hartthaler.
Mitwirkende: Norman Manea, Katja Rainer, Evelyne Mayer, Harvey
Keitel, Tanja Kloubert, Eduard Weissmann, Johann Schlamp.
Format: 35mm, 1:1.66, Farbe. Länge: 134 Minuten, 24 Bilder/Sek.
Sprache: Deutsch.
Uraufführung: 7. Februar 2004, Internationales Forum, Berlin.
Deutscher Verleih: Salzgeber & Co. Medien GmbH, Friedrichstraße 122,
10217 Berlin, Deutschland. Tel.: (49-30) 28 52 90 90, Fax: (49-30) 28
52 90 99. Email: info@salzgeber.de; http://www.salzgeber.de
Pressematerial: www.kinopresseservice.de
Gespräch mit Volker Koepp
Ich habe einiges dafür getan, daß Czernowitz etwas bekannter wurde,
aber der größte Teil der Menschheit weiß immer noch nicht, wo das
liegt.
Erika Richter: Was war der konkrete Anlass für diesen Film? Waren das
gewissermaßen offene Enden von Herr Zwilling und Frau Zuckermann?
Volker Koepp: Bekanntermaßen fahre ich immer gern noch einmal dahin,
wo ich schon einmal gedreht habe. Ich will nicht von Wittstock
sprechen, wo ich fünfundzwanzig Jahre lang hingefahren bin. Vielleicht
drehe ich später auch noch einmal einen Film in der Uckermark,
um meine Affinität zu Brandenburg, meiner engeren Heimat, auszudrücken.
Aber auch an fremde Orte reise ich gerne. Nachdem ich das
erste Mal in Czernowitz war, um den Film Herr Zwilling und Frau Zuckermann
zu drehen, bin ich danach noch zweimal hingefahren, einfach,
um den Kontakt zu halten. Das ist ja die andere Seite der Filmarbeit.
Selbst wenn man an einem Ort aufgehört hat, Filme zu machen, wie ich
in Wittstock, halte ich immer weiter den Kontakt zu den Leuten, mit
denen ich gedreht habe. Im Laufe der Jahre wird das natürlich etwas
schwierig mit der zunehmenden Zahl von Menschen, die man kennen
gelernt hat und mag. Als Herr Zwilling und Frau Zuckermann 1999 beim
Internationalen Forum des Jungen Films lief, fiel mir ein Mann auf,
der in jeder Vorführung war, aber nie etwas sagte. Erst bei der letzten
Vorführung im Haus der Tschechischen Kultur meldete er sich. Er war
ein Czernowitzer, der allerdings diese Stadt nicht mehr bewusst erlebt
hat, denn er wurde dort 1943 im Ghetto geboren. Das war Herr Weissmann,
Cellist im Deutschen Symphonieorchester. Er sprach über Czernowitz,
und ich habe, wie oft bei solchen Vorführungen, seine Adresse
aufgeschrieben und ihm gesagt, dass ich mich bestimmt wieder melde,
weil das Thema für mich längst nicht abgeschlossen war. Dann kamen
andere Vorführungen, in anderen Ländern, Frankreich, England, und
immer tauchten Leute aus Czernowitz auf. Die Älteren erkannte ich schon
bald an ihrer Art zu sprechen, an ihrem besonderen Bukowiner Deutsch.
Interessant fand ich, dass die Generation, die eigentlich gar nichts
mehr mit Czernowitz zu tun hatte, ein großes Interesse zeigte. Bei der
Uraufführung von Herr Zwilling und Frau Zuckermann in Wien lernte ich
Evelyne Mayer kennen, die mir von ihrer Kindheit erzählte; damals fing
ich an, darüber nachzudenken, dass es interessant wäre, einen Film mit
Leuten zu machen, die nicht mehr direkt mit Czernowitz zu tun haben,
bei denen der familiäre Herkunftsort aber in irgendeiner Weise nachwirkt.
Dazu kam dann noch die Begegnung mit dem rumänischen Schriftsteller
Norman Manea, den ich über gemeinsame Freunde in Berlin kennen
lernte. Außerdem sind viele Czernowitzer und ihre Nachfahren durch
die Zeitung ‘Die Stimme‘ weltweit miteinander vernetzt. Ich hatte also
Familie Weissmann in Berlin, die beiden Schwestern Evelyne und Katja
in Wien und Norman Manea, der Ende der achtziger Jahre aus Rumänien
emigrierte und heute am Bard College in der Nähe von New York
eine Professur hat. Harvey Keitel lernte ich auch durch den Film Herr
Zwilling und Frau Zuckermann kennen. Er las Gedichte von Paul Celan
auf einer Veranstaltung in Frankfurt/Oder. Maria Magdalena Schwaegermann,
die damals noch am Hebbel Theater war, machte ihn darauf aufmerksam,
dass es einen Film gäbe, der in der Geburtsstadt von Celan,
in Czernowitz gedreht worden war. Sie gab ihm eine Kassette und wir
trafen uns erstmals während seiner Dreharbeiten mit Istvan Szabo in
Berlin. Es stellte sich heraus, dass auch Keitels Mutter aus der Gegend
um Czernowitz stammte und als junge Frau noch vor dem Zweiten Weltkrieg
nach Amerika ausgewandert war. Ihr Heimatdorf wiederum lag
docunicht
weit entfernt von Norman Maneas Geburtsort im heute rumänischen
Teil der Bukowina. Diese verschiedenen Menschen kamen mir
als Personen für meinen Film ganz überzeugend vor.
E.R.: Und wann war der Punkt erreicht, an dem du dich entschiedst,
den Film zu machen?
V.K.: Machen wollte ich ihn immer, aber ich wollte mich ja nicht zum
Spezialisten für Czernowitz entwickeln. Der Film Herr Zwilling und Frau
Zuckermann entstand mit Menschen, die ich zufällig kennen gelernt
hatte, als ich mir die Stadt ansehen wollte, in der Paul Celan geboren
ist. Die Entscheidung fiel, als mir klar wurde, dass ich da einfach noch
einmal hin musste. Das war genauso wie 1974, als ich in Wittstock
anfing und wusste, dass es noch einiges darüber zu erzählen gab. Auch
über Czernowitz gibt es noch einiges zu sagen: Über die alten Leute,
die wenigen, die es noch gibt. Herr Zwilling ist ja 1999 gestorben, und
Frau Zuckermann, die auch in diesem Film noch einmal vorkommen
sollte, starb 2002 kurz vor Beginn der Dreharbeiten. DIESES JAHR IN
CZERNOWITZ ist auch eine Erinnerung an diese beiden Menschen. Aber
ich wollte auch noch einmal genauer auf die Gegenwart an diesem Ort
blicken. Vorher drehte ich allerdings Kurische Nehrung und Uckermark.
E.R.: Also liegen die Anfänge des Projektes schon so lange zurück.
V.K.: Ja, der erste Gedanke entstand bald nach 1999. Vor drei Jahren
ungefähr begann ich, etwas aufzuschreiben und mich um die Finanzierung
zu kümmern. Bei diesem Film bestand das Abenteuer darin, dass
man für die Figuren keine kompletten, porträthaften Formen finden
konnte. Es ging stattdessen mehr darum, dass sich die Figuren und
ihre Erinnerungen und Reflexionen ineinander verzahnen. Die Themen
Assimilation und Exil, über die Norman Manea mit dem Präsidenten
des Bard Colleges spricht, ergänzen das Gespräch Harvey Keitels mit
dem Ukrainer, den er zufällig in Brighton Beach auf der Straße trifft.
Am Ende reichte dieser Film für mich weit über Czernowitz hinaus. Ich
merkte im Laufe der Zeit, dass er mit ganz gegenwärtigen Themen zu
tun hat: mit Exil, mit Heimat, mit Weggehen und Ankommen, mit Sprache
etc.
E.R.: Der Film ist sehr schön. Aber er ist anders als deine vorangegangenen.
Er versucht, die Brücke von der Vergangenheit in die Normalität
der Gegenwart zu schlagen. Das bringt es aber gleichzeitig mit sich,
dass dein neuer Film, verglichen mit Herr Zwilling und Frau Zuckermann,
der melancholisch und herzzerreißend ist, etwas sachlicher wirkt. Man
erlebt die Mitwirkenden weniger erzählend als reflektierend. Auch das
ist neu für dich. Natürlich gibt es dieses Erzählerische, etwa wenn Weissmann
erzählt, dass ein SS-Mann zu seiner Großmutter, als sie abtransportiert
wurde, sagte: „Komm, Oma, du stirbst bei uns.“ Das ist ein
Moment, der einem ans Herz greift. Oder wenn er von dem Cello erzählt,
das man ihm für das Probespiel in Berlin geborgt haben soll.
Aber im Großen und Ganzen wird mehr über die Bedeutung nachgedacht,
die Czernowitz einmal hatte bzw. die es immer noch hat. Zum
Beispiel sprechen die beiden Schwestern darüber, dass sie eigentlich
erstaunt darüber waren, festzustellen, dass diese Stadt noch immer so
wichtig für sie ist. Trotzdem habe ich es bedauert, dass das Atmosphärische,
das sonst in deinen Filmen eine bedeutende Rolle spielt – Landschaft,
Stadt etc. – doch ziemlich zurückgetreten ist.
V.K.: Es war mir schon klar, dass dieser Film anders werden würde. Wenn
man beinahe jedes Jahr einen Film macht, finde ich das natürlich. Zuerst
habe ich das gar nicht bemerkt. Es fiel mir nur auf, dass bestimmte
Dinge sich plötzlich sperrten, als ich sie wie sonst drehen wollte. Das
kann damit zusammenhängen, dass die große Anzahl der Personen
einem Zwänge auferlegt. Sie alle sind starke Persönlichkeiten, die Raum
brauchen. Aber ich finde diese Erfahrung wichtig für mich. Hier im
Forum liefen vor beinahe dreißig Jahren meine ersten beiden Filme
über die Mädchen in Wittstock. Ich hätte über diesen langen Zeitraum
nicht Jahr für Jahr Filme machen können, wenn ich versucht hätte, die
Machart jeweils zu kopieren. Auch wenn sich vielleicht so etwas wie
‘Stil‘ herausgebildet hat, prägt doch auch beim Dokumentarfilm das
Sujet die Struktur des Films. Die Wismut ist formal natürlich anders als
Kalte Heimat. In DIESES JAHR IN CZERNOWITZ erzählen Menschen, die
auf unterschiedliche Art und Weise in ihrem Leben mit der Erfahrung
des Exils konfrontiert sind. Es sind direkte und indirekte Erfahrungen,
die offenbar über die Generationen weiterwirken und die individuellen
Lebensgeschichten beeinflussen. Darüber wird im Film reflektiert.
Das finde ich aber nicht sachlich oder abstrakt. Ein Beispiel: Die Szene
mit Norman Manea in seinem kleinen New Yorker Büro, wo er über die
Sprache als Heimat nachdenkt, die er wie ein Schneckenhaus mit sich
trägt, ist für mich auch emotional stark. Man denke auch an Manea am
Fluß, am Dnistr. Von Czernowitz ist in diesem Film auch mehr zu sehen
als in Herr Zwilling und Frau Zuckermann – auch wenn das nicht so
auffällt, weil die Bilder mit Gängen oder mit Fahraufnahmen verbunden
sind. Man sieht von der Atmosphäre der Stadt, von der Substanz,
die erhalten geblieben ist, in diesem Film mehr.
E.R.: Erstaunlich, dass diese Stadt so erhalten blieb. Warum ist sie eigentlich
nicht zerstört worden?
V.K.: Im Ersten Weltkrieg gab es einige kleinere Zerstörungen. Im Zweiten
Weltkrieg gehörte Czernowitz zum Einflussgebiet der Achsenmacht
Rumänien. Der rumänische König schwenkte 1944 um und verließ die
Allianz mit Deutschland. Die Stadt war einfach kein Hauptkampfgebiet.
Deshalb ist sie nicht zerstört worden.
E.R.: Warum beginnt der Film gerade in Berlin?
V.K.: Da wohne ich. Außerdem ist Eduard Weissmann, der Berliner Cellist,
der Erste, den ich getroffen habe. Schon 1999, als Herr Zwilling
zur Premiere hier war, lud uns Herr Weissmann ein. Ich habe zunächst
sogar versucht, den Film anders zu strukturieren, aber der Filmanfang
mit Berlin gefiel mir am besten.
E.R.: Auch das gehört zur Besonderheit des Films: dass er nicht mehr
einen geschlossenen Kosmos beschreibt, sondern diesen verläßt. Berlin.
New York. Die Czernowitzer befinden sich in der Welt und kehren
zum Kern zurück.
V.K.: Es gibt eine kurze Szene am Anfang, in der der Onkel von Frau
Weissmann erzählt, dass man ihn in Venezuela immer frage, ob
Czernowitz eine Million Einwohner hatte, weil diese so miteinander
vernetzt und über die Welt verstreut sind. Mit Czernowitz muss es wirklich
etwas Besonderes auf sich haben – wenn ein solcher Flecken immer
wieder Menschen hervorbringt, die ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl
haben! DIESES JAHR IN CZERNOWITZ ist ja auch ein Film
über Gehen und Bleiben, wie wir es etwa an Tanja, der jungen Ukrainerin
beobachten, die zum Schluss die Stadt verlässt. Tanja lernte ich
übrigens kennen, als ich Frau Zuckermann zwischendurch einmal besuchte.
Wir waren nicht zum Drehen, sondern einfach nur zu Besuch
da. Damals fand gerade eine Rose-Ausländer-Tagung statt. Rose Ausländer
stammt auch aus Czernowitz. Die Tagung fand im Theater statt,
und Tanja übersetzte im Foyer des Theaters irgendwelche Dinge. Wir
haben uns ihre Adresse aufgeschrieben, denn mit unserem Russisch
kommen wir in der Ukraine meistens nicht sehr weit. Als es dann wirklich
losging mit den Dreharbeiten, riefen wir sie an. Und dabei merkte
ich, dass sie auf eine andere Weise so ein Czernowitzer Mensch ist: Sie
ist Ukrainerin, und sie ist wieder so ein mehrsprachiges Wesen. Früher,
heißt es, konnte jeder in Czernowitz fünf Sprachen. Das kann sie inzwischen
auch. Jetzt erzählte sie mir, dass sie – nachdem sie Englisch und
Deutsch, Russisch und Ukrainisch sowieso, Polnisch und Französisch
spricht – in Jena noch Spanisch dazu genommen hat, weil die Deutschen
so langsam studieren.
E.R.: Tanja ist eine wichtige Figur für die Brücke zwischen Vergangenheit
und Gegenwart. Aber wenn ich dich so erzählen höre, merke ich
wieder einmal, wie sehr Dokumentarfilm mit Leben zu tun hat oder
vielmehr eine besondere Art von Leben ist.
V.K.: Tanja war in dem Exposé, das ich schrieb, nicht enthalten. Das hat
sich wirklich so ergeben. Dadurch sind zugleich andere wichtige Dinge
hinzugekommen. So ist die Szene am Pruth, wo Tanja mit ihren Kommilitonen
ihren Studienabschluß feiert, für Celan-Kenner von großer
Bedeutung. An dieser Stelle hat er seinen Freunden seine ersten Gedichte
vorgelesen.
Es wird viel vom Mythos Czernowitz geredet. Aber ich bin immer davon
ausgegangen, dass dort auch gegenwärtiges Leben stattfindet. Für
diesen Aspekt war Tanja sehr wichtig. Im Winter, vor fast einem Jahr,
führten wir ein Gespräch mit ihr, das auch im Film enthalten ist, und
dabei merkte ich, wie eng sie mit der Stadt verbunden ist und dass sie
jetzt – wie alle Czernowitzer, die anderswo leben – darunter leidet,
nicht in Czernowitz zu sein. Aber es gehen heute wieder viele weg. Das
wiederholt sich. Heute hat das vor allem mit der Gegenwart und der
ökonomischen Situation im Land zu tun.
E.R.: Hast du auch mit Leuten gedreht, die dann aus dem Film herausgenommen
wurden, weil alles zu umfangreich wurde?
V.K.: Nein. Am Anfang war der Film viereinhalb Stunden lang. Die Länge
des Films hat mit den Figuren zu tun. Sie brauchen ihren Raum,
auch wenn man sie nicht komplett porträthaft erzählen konnte. Ist er
dir lang vorgekommen?
E.R.: Nein, überhaupt nicht.
V.K.: Die schönste Fassung ist natürlich immer die ganz lange. Wenn
man dann sozusagen zurückbaut, gibt es zwischendurch Fassungen,
die überhaupt nicht geglückt sind. Man muss dann erst wieder die
Struktur finden.
E.R.: Wie war die Arbeit mit Harvey Keitel? Wenn er durch Czernowitz
geht, hat man das Gefühl, dass plötzlich alles zur Kulisse wird.
V.K.: Ja, aber nun haben mir die alten Czernowitzer mehrfach gesagt,
dass Czernowitz tatsächlich nur noch eine Kulisse ist. Die alten Häuser
sind noch da, aber die Menschen, die früher darin wohnten, diese Menschen
verschiedener Völker gibt es nicht mehr. Dasselbe passiert, wenn
man nach Lemberg/Lwow (Lwiw) fährt, wo alles aussieht wie der dritte
Bezirk in Wien. Dieses frühere Leben, in dem zum Beispiel in der Herrengasse
in Czernowitz alle Sprachen der Welt gesprochen worden sein
sollen, gibt es natürlich nicht mehr, und insofern ist dieses Bild mit
der Kulisse, finde ich, gar nicht so schlecht. Nun ist natürlich klar, dass
viele Zuschauer auf die verschiedensten Dinge achten werden, wenn
sie einen Schauspieler im Dokumentarfilm sehen. Das ist mir relativ
schnuppe, nachdem er im alten jüdischen Viertel von Czernowitz dieses
Gedicht von Celan gelesen hat, ‘Es war Erde in ihnen‘. Das ist einfach
großartig. Ein amerikanischer Schauspieler kehrt hier wirklich zu
seinen Wurzeln zurück. – Ich habe einiges dafür getan, dass Czernowitz
etwas bekannter wurde. Aber der größte Teil der Menschheit weiß immer
noch nicht, wo diese Stadt liegt. Andererseits ist dieses ganze
Thema auch ein internationales. Die Arbeit an dem Film war ja in gewisser
Weise eine Weltreise. Dies alles hat viel mit der sogenannten
Globalisierung zu tun und auch damit, dass man – wie Norman Manea
sagt – das Exil, auch wenn es schwer fällt, ehren muss. Und es hat mit
diesem Celan-Text, den Manea liest, zu tun: mit dem Wandern durch
die Welt. Auch in DIESES JAHR IN CZERNOWITZ geht es im Grunde genommen
um Lebensgeschichten. Einer erzählt viel, ein anderer möchte
nicht so viel darüber sprechen. Es geht um den Reichtum menschlichen
Lebens.
E.R.: In diesem Film sprechen alle von wirklich durchlebten und empfundenen
Dingen. Gesprochenes Wort ist nicht gleich gesprochenes
Wort im Film. Ich empfinde diesen Film als eine Art Abschied von
Czernowitz, vielleicht als eine Verabschiedung von dem Mythos Czernowitz
mit Ausblick in die Realität Czernowitz. Aber ganz wird man diesen
Mythos nie verabschieden können. Wohin gehst du als nächstes? Welchen
Film planst du?
V.K.: Ich weiß es noch nicht. Ich würde gerne noch einmal an der Ostsee
entlang wandern. Nach diesem Film kann ich mir, glaube ich, wieder
etwas Provinzielleres vornehmen. Ich denke auch darüber nach,
dem Thema der Entvölkerung im nordöstlichen Teil Brandenburgs nachzugehen.
Das ist ein wichtiges Thema. Und das alles spielt sich mitten
in Europa ab – wenn Polen und Litauen dazugehören, dann ist hier
Mitteleuropa. Da ist noch viel Stoff.
E.R.: Die Provinz ist stets eine interessante Gegend.
V.K.: 1989/90 habe ich in Zehdenik gedreht und in Wittstock. Stets
etwas abseits der großen Fernsehereignisse. Das nahe Lebensumfeld
interessiert mich immer. Und dann meine Lieblingslandschaften...
Das Gespräch führte Erika Richter am 14. Januar 2004 in Berlin.
|
|